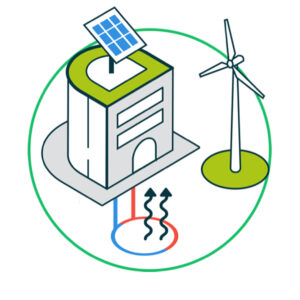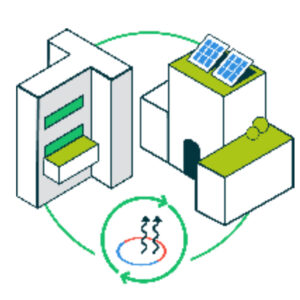Urban
Challenge
Motivation
Urban Challenge bringt Akteure der Wirtschaft mit Experten aus Forschung und Entwicklung zusammen. Die Urban Challenge ist eine Pilotaktivität der europäischen Partnerschaft Driving Urban Transitions.
Für die komplexen Transformationsprozesse benötigen Akteure wie Stadtverwaltungen, Energieversorger und Immobilienunternehmen oft jeweils passende Forschungspartner. Mit dem Format Urban Challenge unterstützen wir diese durch ein entsprechendes Match-Making.
Grundsätzlicher Ansatz der Urban Challenge ist die Fokussierung auf konkrete Fragestellungen der Akteure. Experten aus Forschung und Entwicklung werden dabei herausgefordert, Projekte zur Beantwortung der Fragen vorzuschlagen.
Damit bringen wir die Akteure mit Forschungsinstitutionen zusammen, um Transformationsaktivitäten und Investitionsentscheidungen zu beschleunigen.
Herausforderungen
Borkum
Geothermie, Großwärmepumpen und Energiesystemmodellierung
Wernigerode
Holzbau sowie Quartiersenergieversorgung
Lemgo
Oberflächennahe Geothermie und Einbindung in bestehendes Fernwärmenetz
Borkum
Wie kann die Wärmeversorgung der Stadt Borkum mit Tiefengeothermie 100% klimaneutral gestaltet werden?
Ein wesentlicher Baustein und Voraussetzung dafür soll die Anbindung von Tiefengeothermie in das vorhandene Fernwärmenetz sein. Der Standort liegt aufgrund seiner Lage im Norddeutschen Becken geologisch günstig, entsprechende Potentialuntersuchungen und Vorarbeiten liegen vor.
Die Herausforderung ist die Optimierung des Gesamtsystems in Hinblick auf geothermische Energiebereitstellung unter Berücksichtigung etwaiger zusätzlicher Technologieoptionen wie z.B. saisonaler Speicherung oder Verstromung.
Wernigerode
Wie können trotz laufend steigender Baukosten und zunehmendem Kostendruck eine hohe Energieeffizienz und möglichst klimaschützende Bauweise erreicht werden?
Wie kann für geplante Bauvorhaben trotz gestiegener Baukosten und beschränkter Budgets der Anteil von Holz an den insgesamt verwendeten Baustoffen erhöht werden?
Welche technischen Ansätze und Komponenten – z.B. Wärmepumpen, (Eis-)speicher, Solarthermie – könnten dazu beitragen, dass Energiekonzept unter gegebenen wirtschaftlichen Randbedingungen möglichst klimafreundlich umzusetzen?
Lemgo
Wie kann durch die Integration von oberflächennaher Geothermie in großtechnischem Maßstab 100% erneuerbare Energie im Fernwärmenetz realisiert werden?
Welche innovativen Konzepte würden sich eignen, um oberflächennahe Geothermie in großtechnischem Maßstab in das bestehende Fernwärmesystem zu integrieren?
Wie kann das Erdreich bei den geplanten hohen Entnahmemengen regeneriert werden? Wie lassen sich die Effizienz des Systems erhöhen und die Gesamtwirtschaftlichkeit verbessern?
Ablauf
Dieses neue Unterstützungsformat soll es den Akteuren ermöglichen, verschiedene Forschungsteams und deren Ansätze kennenzulernen. Der Ablauf gliedert sich daher in folgende drei Schritte:
Interessierte Akteure, d.h. Stadtverwaltungen, Immobiliengesellschaften oder Energieversorger, haben ihre Problemstellung und ihre Erwartungen an die zukünftigen Forschungspartner formuliert.
Experten aus Forschung und Entwicklung sind nun dazu aufgerufen, möglichst konkrete Vorschläge zu machen, wie die jeweilige Herausforderung adressiert werden kann. Diese sollen den Akteuren im Rahmen einer Kurzpräsentation in Form eines Pitchings präsentiert werden.
Das Format des Pitchings ist grundsätzlich frei. Es wird jedoch empfohlen, maximal 15 Minuten für die eigentliche Präsentation und 15 Minuten für Fragen und Diskussion vorzusehen. Insgesamt stehen damit jedem Forscherteam 30 Minuten zur Verfügung, um bei den Akteuren Interesse zu wecken.
Die Präsentationen sowie die anschließende Diskussion sind nicht öffentlich und finden vor Vertretern der Akteure und dem Organisationsteam (PtJ bzw. DUT) virtuell (über zoom oder MS-Teams) statt.
Schwerpunkt der Präsentation sollen mögliche Projektansätze der potentiellen Forschungseinrichtung sein (max. 5 PP-Folien), d.h: Wie können die Herausforderungen und Fragestellungen adressiert werden? Welche methodischen Ansätze stehen zur Auswahl? Wie könnten mögliche Arbeitsschritte aussehen?
Zudem sollte der Aufwand für die vorgeschlagenen Arbeiten und die möglichen Projektformate (z.B. Mikroprojekt, Verbundvorhaben) grob abgeschätzt werden (Projektlaufzeit, Personenaufwand, etc auf max. einer PP-Folie).
Vorstellung der Institution, Referenzen etc. bitte auch auf max. eine PP-Folie beschränken.
In Folge obliegt es den Akteuren, mit welchen Experten weiterführende Gespräche geführt werden, um gemeinsam weiterzuarbeiten und – im Regelfall – mit diesen gemeinsam eine Projektskizze zu formulieren und in einem passenden Förderprogramm einzureichen.
Teilnahme und Kontakt
Sie sind Experte in einem dieser Themenfelder und können zur Beantwortung der Fragestellungen beitragen?
Dann melden Sie sich gerne mit einer formlosen Interessensbekundung per Mail:
FAQ
Hier werden eventuelle Fragen beantwortet.
Ja, die Videos sind auf dem Youtube-Kanal der Urban Challenge unter https://www.youtube.com/@Urban_Challenge zu finden.
Mit der Teilnahme bietet sich für Experten aus Forschung und Entwicklung die Möglichkeit ihre Expertise zur Beschleunigung der Transformation zielgerichtet einzubringen.
Es besteht dabei die Chance gemeinschaftlich mit treibenden und innovativen Akteuren wirksame Forschungsprojekte zu realisieren, die auf konkreten Fragestellungen der Akteure beruhen.
Grundsätzlich sollen, basierend auf den jeweiligen Problembeschreibungen, konkrete Lösungsansätze vorgestellt werden.
Selbstverständlich werden keine fertigen Lösungen oder Projektskizzen erwartet. Aus den Beiträgen sollen jedoch die grundsätzliche Herangehensweise und die Lösungskompetenz der Forschungseinrichtung hinsichtlich der konkreten Fragestellung erkennbar sein.
Bei den Herausforderungen wird in den Informationsblättern genauer ausgeführt, welche Aspekte in der jeweiligen Präsentation adressiert werden sollen.
Das Format der Präsentation ist grundsätzlich offen. Es wird jedoch empfohlen, keinesfalls mehr als 10 Power Point Folien vorzusehen (davon maximal eine zur Institutspräsentation und eine weitere zu Referenzprojekten).
Gerne können jedoch ergänzend begleitende Unterlagen (z.B. Vorstellung des Institutes, Liste ähnlicher Projekte, Referenzen) übermittelt werden.
Präsentationen, welche ausschließlich (oder vorwiegend) lediglich eine Institutspräsentation bzw. die Vorstellung von Referenzprojekten zum Inhalt haben, entsprechen nicht dem Charakter dieses Formates und sind daher nicht erwünscht.
Beim Pitching handelt es sich um ein erstes Kennenlernen. Das Format verfolgt dabei die Idee, den Aufwand für die Forschungseinrichtungen für ein Kennenlernen auf ein sinnvolles Maß zu begrenzen.
Ja, gemeinsame Präsentationen sind möglich und erwünscht. Allerdings stehen auch in diesem Fall insgesamt maximal 30 Minuten zur Verfügung.
Dies hängt stark von der Herausforderung ab und ob bzw. in welcher Weise sie bereits mit ähnlichen Forschungsfragen befasst waren. Der Aufwand kann zwischen vernachlässigbar und mehreren Stunden liegen.
Nein. Weder für die Akteure noch für die Experten fallen Kosten an. Der Aufwand wird nicht erstattet. Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden.
Bei diesem Format stehende die präsentierenden Forschungsakteure im Wettbewerb zueinander (auch wenn für ein Projekt, abhängig von der konkreten Herausforderung, mehrere Forschungspartner mit sich ergänzenden Kompetenzen notwendig sein können).
Daher finden die Präsentation nicht öffentlich, sondern in einem vertraulichen Rahmen statt (ausschließlich Sie als Experten der präsentierenden Einrichtung, die Akteure, deren Herausforderungen bearbeitet werden und das Organisationsteam (PtJ bzw. DUT)).

EUROPEAN PARTNERSHIP

© 2026 All Rights Reserved.